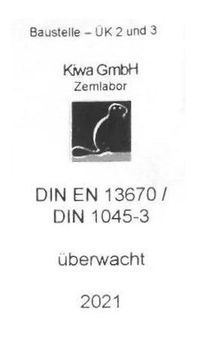Schimmelpilzprophylaxe
Das Ziel der Schimmelsanierung ist nach zwingend vorhergehender Abstellung der Schadensursache aus hygienischen Gründen und Gründen der Gesundheitsvorsorge die Beseitigung des Schimmelbefalls und des querverdrifteten Schimmels. Dieses beinhaltet nach Beseitigung der Schadensursache die Entfernung des befallenen Materials, die Dekontamination der Einwirkungsbereiche und die anschließende Wiederherstellung des unbeschadeten Ursprungszustandes, wobei die Sanierungsziele je nach Nutzungsklasse (z.B. Wohnraum, Büroräume) variieren können. Ziel einer Schimmelsanierung ist hier regelmäßig die Wiederherstellung einer üblichen, gesundheitsunbedenklichen Hintergrundbelastung der Raumluft durch Schimmelpilze und deren Bestandteile, nicht jedoch ein Reinraumzustand wie er in Krankenhäusern gefordert ist.
Dabei ist zunächst die Schadensursache abzustellen. Dieses ist bei erkennbaren Ursächlichkeiten (Leckage/Undichtigkeit/Minderdämmung usw.) regelmäßig mit entsprechenden Aufwendungen möglich. Schwerer ist es hier bei ungeklärten / sich überlagernden Ursächlichkeiten. Hier sind häufig weitergehende Untersuchungen, beispielsweise des Nutzerverhaltens, der Luftdichtheit der Wohnung ( Prüfung der Einhaltung der Mindestanforderung an den nutzerunabhängigen Luftwechsel entsprechend die 1946-6 sofern relevant) usw. erforderlich. Häufig handelt es sich bei den Problemen um sehr grenzwertige Erscheinungen, wo alleine durch Optimierungen im Bereich der Baustoffeigenschaften, der Wärmezufuhr und der Feuchteabfuhr (im Rahmen von effizienten Lüftungen) Stellschrauben bestehen, um ein funktionierendes System herzustellen / wiederherzustellen.
Typische Problematiken werden hier als Sommerkondensat- oder Winterkondensatproblematiken unterteilt:
a.) Sommerkondensatproblematik:
Warme Luft kann mehr absolute Feuchtigkeit speichern als kalte Luft. Wenn im Sommer 30° warme Luft mit bis zu 30 g Wasserdampf pro Kubikmeter in 10° kalte Kellerräume oder Souterrainwohnräume gelangt, können pro Kubikmeter Luft über 20 g Wasserdampf an den kalten Außenbauteilen (Wänden/Böden) kondensieren, wodurch es infolge nach längerer Einwirkung zu Feuchteproblemen/Schimmelproblemen kommen kann. Anhand üblicher Raumluftfeuchtemessgeräte, die nur die relative Raumluft anzeigen, sind solche Problematiken im Wesentlichen nicht für den Laien erkennbar bzw. steuerbar. Hier empfiehlt sich häufig eine einfache Automatisierung mittels technischer Lüftungsgeräte, sinnvollerweise mit Wärmerückgewinnung und intelligenten Steuerungen, die die absoluten Luftfeuchtewerte errechnen und Lüftungsvorgänge auf den Zeitpunkt verlagern, in denen die Außenluft trockner ist als die Innenluft. Das muss nicht zwangsweise teuer sein und geht häufig mit überschaubaren Aufwendungen. Sinnvollerweise werden diese Systeme in Kombination mit temporär arbeitenden Luftentfeuchtern eingesetzt, um auch bei andauernd schwülwarmer Außenwitterung schimmelkritische Luftfeuchtigkeiten auszuschließen.
Der Vorteil entsprechender technischer Lüftungsmaßnahmen ist hierbei vielseitig:
1. hygienischer Luftwechsel (der verbrauchte Sauerstoff wird ersetzt, erhöhte CO²-Konzentrationen und Raumluftfeuchtigkeiten werden reduziert, ausdünstende Schadstoffe / Gerüche / Wohngifte aus Beschichtungen, Mobiliar, Verpackungen usw. werden verdünnt / abgeführt. Quellen solcher Wohngifte können nicht nur die Außenluft und der Bauuntergrund (Thema Radon, usw.) sein, sondern auch besonders im Inneren liegende Emissionen aus Baumaterialien, Einrichtungsgegenständen und natürlich von den Nutzern selber oder ihren Aktivitäten sein. Dazu gehören u.a. Staub, Feinstaub, Ausgasungen (Ozon, CO², Radon, usw.), Pollen, Schimmelpilzsporen und mikrobielle Ausgasungen (Mykotoxine), Formaldehydausdünstungen, Asbestfasern, usw..
2. zugeführte Frischluft kann gefiltert werden
3. durch die Regelung einer definierten Luftwechselrate und Nutzung von Wärmetauschern zur Wärmerückgewinnung werden Lüftungswärmeverluste reduziert
4. außenseitiger Verkehrslärm kann beim Lüftung reduziert werden
Gefördert werden kann dieses beispielsweise durch den Einsatz von Wandputzen mit geringen Diffusionswiderständen, die in der Lage sind, Feuchtspitzen temporär zwischenzuspeichern und nachfolgend bei günstiger Situation schnell wieder abzugeben. Auch Klimaplatten können hier einen entsprechenden förderlichen Beitrag leisten.
Lassen Sie sich diesbezüglich gerne von uns beraten.
b.) Winterkondensatproblematik:
Bei kalten Außentemperaturen kommt es regelmäßig insbesondere im Bereich von Wärmebrücken zu schimmelpilzkritischen Unterkühlungen, typischerweise in den Außenwand-Eckbereichen, Außenwand-Deckenanschlussbereichen, Fensterstürzen, Fensterlaibungen, usw.. Diese sind zum Teil unvermeidbar und zum Teil mietrechtlich häufig nicht zu bemängeln, wenn die betroffenen Bauteile die Mindestanforderung an den Wärmeschutz zum Zeitpunkt der Gebäudeerstellung erfüllen, was regelmäßig, so unsere Untersuchungen, der Fall ist. Die Ermittlung der Schadensursache ist hierbei auch aufgrund vorliegender Überlagerungen mehrerer Ursachen / der Existenz solcher nicht bemängelungsfähigen Ursachen nicht immer einfach. Hier bedarf es umfassender Begutachtungen und einer abschließenden praxistauglichen Expertise.
Häufig sind dabei nach unseren Untersuchungen Unterschreitung des erforderlichen nutzerunabhängigen Mindestluftwechsels nach die 1946-6 (soweit relevant) oder unzureichende Feuchtabfuhren im Rahmen von ineffizienten Lüftungsvorgängen zu beobachten. Sicherheit bringen kann hierbei abschließend diesbezüglich nur die Prüfung der Ursachen beispielsweise entsprechend dem Ausschlussverfahren in Anlage 3 der Schimmelleitfadens unter Überprüfung der Erfordernis lüftungstechnischer Maßnahmen zur Gewährleistung eines ausreichenden nutzerunabhängigen Luftwechsels im Rahmen von Luftdichtheitsprüfungen und einer gegebenenfalls zu realisierenden technischen Belüftung. Das muss gerade bei dezentralen Lüftungsgeräten nicht zwangsweise aufwendig und teuer sein. Gerade bei kondensatbedingten Feuchteproblematiken kann hier häufig das System durch den Einsatz von Lüftungstechnik, optimalerweise mit einer Wärmerückgewinnung, auch mit überschaubaren Aufwendungen auch energetisch optimiert werden.
Der Vorteil entsprechender technischer Lüftungsmaßnahmen ist auch hier vielseitig:
1. hygienischer Luftwechsel (der verbrauchte Sauerstoff wird ersetzt, erhöhte CO²-Konzentrationen und Raumluftfeuchtigkeiten werden reduziert, ausdünstende Schadstoffe / Gerüche/Wohngifte aus Beschichtungen, Mobiliar, Verpackungen usw. werden verdünnt / abgeführt. Quellen solcher Wohngifte können nicht nur die Außenluft und der Bauuntergrund (Thema Radon, usw.) sein, sondern auch besonders im Inneren liegende Emissionen aus Baumaterialien, Einrichtungsgegenständen und natürlich von den Nutzern selber oder ihren Aktivitäten sein. Dazu gehören u.a. Staub, Feinstaub, Ausgasungen (Ozon, CO², Radon, usw.), Pollen, Schimmelpilzsporen und mikrobielle Ausgasungen (Mykotoxine), Formaldehydausdünstungen, Asbestfasern, usw..
2. zugeführte Frischluft kann gefiltert werden
3. durch die Regelung einer definierten Luftwechselrate und Nutzung von Wärmetauschern zur Wärmerückgewinnung werden Lüftungswärmeverluste reduziert
4. außenseitiger Verkehrslärm kann beim Lüftung reduziert werden
Gefördert kann dieses beispielsweise durch den Einsatz von Wandputzen mit geringem Diffusionswiderstand, die in der Lage sind, Feuchtspitzen temporär zwischenzuspeichern und nachfolgend bei günstiger Situation schnell wieder abzugeben. Auch Klimaplatten können hier einen entsprechenden förderlichen Beitrag leisten.
Hier lohnt sich häufig, schrittweise vorzugehen und an den „richtigen Stellschrauben zu drehen“.
Gerne können wir sie in diesen Fällen umfänglich beraten.
... und nein
- Schwarzer Schimmel ist nicht zwangsweise gefährlicher als andersfarbiger
- Desinfektionen stellen bei Schimmelpilzschäden entsprechend des Schimmelleitfadens des Umweltbundesamtes (2024) keine geeignete und ausreichende Sanierungsmethode dar
- Abschottungen von Schimmelpilzbefallstellen sind nicht dauerhaft und ausreichend (vgl. Auswirkungen von Mykotoxinemmissionen)
- VOC-Messungen und MVOC-Messungen müssen nicht zwangsweise Sicherheit bringen
- Schimmel sollte man nicht mit Essig bekämpfen
- befallene Putze müssen nicht zwangsweise abgeschlagen werden
- befallenes Mobiliar muss auch nicht zwangsweise entsorgt werden
- Schimmelpilze sind ubiquitär, also überall vorhanden und nicht zwangsweise gefährlich (vgl. Edelschimmel)
… zum Thema Sanierputz:
- Die von uns eingesetzten Spezialputze sind im Gegensatz beispielsweise zu den handelsüblichen Sanierputzen nach WTA-Norm nicht durch chemische Zusätze hydrophobiert. Das Feuchtemanagement selber erfolgt über ein spezielles Feinporensystem und wird rein physikalisch gesteuert. Durch die stark sorbierenden Eigenschaften der Putze/Sanierplatten können auch bei niedrigen Oberflächentemperaturen Kondensatvorgänge reduziert bzw. vermieden werden und somit der Schimmelwahrscheinlichkeit entgegengetreten werden. Untersuchungen haben diesbezüglich gezeigt, dass die von uns verwendeten Putze eine höhere Verdunstungsrate (+50 bis +120 %) im Vergleich zu üblichen WTA-Sanierputzen aufweisen.
- Die verwendeten Spezialputze nehmen nachfolgend keine häufig problematischen Salzbelastungen auf, da Kapillarfeuchtetransporte im Wesentlichen verhindert werden. Unvermeidbare geringfügig aufgenommene Salze zeigen hier bei entsprechenden Untersuchungen keinen Trend zur Wanderung an die Putzoberfläche, so dass das Auftreten von salzbegründeten Putzzerstörungen vermieden wird. Der Spezialputz bleibt dauerhaft diffusionoffen und oberflächlich trocken.
- Die Putze enthalten keine Kunststoffanteile. Der Putz hat einen rein mineralischen Charakter, von dem keinerlei schädliche Emissionen ausgehem.
- Die Rohstoffe Sand, Zement und Blähglas werden alle von lokalen Anbietern über kurze Transportwege ins Herstellerwerk transportiert, was sich als sehr nachhaltig herausstellt
- Die Zementsteinmatrix der verwendeten Spezialputze weist mit über 35 Vol.-% einen hohen Luftporengehalt und eine im Vergleich zu einfachen Zementputzen eine auch für Altbauten angepasste geringere, aber ausreichende Festigkeit auf
… zum Thema Luftwechsel:
- ein hygienischer Mindestluftwechsel ist nach Gebäudeenergiegesetz (GEG) gefordert und in der DIN 1946-6 seit 2009 konkretisiert. Der hygienische Mindestluftwechsel wird insbesondere für Aufenthaltsräume gefordert, um die Konzentration von Stoffen wie CO², Luftfeuchtigkeit, flüchtige organische Stoffe (VOC) und Gerüche in der Raumluft gering zu halten.
- Der Mensch braucht Sauerstoff zum Leben. Pro Minute atmet der Mensch hierbei rund 7 l Luft ein und aus, das sind insgesamt circa 10.000 l Atemluft pro Tag. Der nötige Sauerstoff ist hierbei nur zu circa 20 % in der Außenluft vorhanden und wird durch Umwandlung beim Ausatmen auf circa 17 % reduziert. In geschlossenen Räumen, wie zum Beispiel Schlafräumen, steigt aus diesem Grunde der CO²-Gehalt der Raumluft regelmäßig sehr schnell an. Ein ruhender Mensch benötigt hier circa 20-30 m³ Frischluft pro Stunde. Wenn ein hygienischer Luftwechsel hier bei ca. 0,3- 0,5 pro Stunde, bedeutet das, dass die Raumluft je nach Raumgröße circa alle 2 Stunden komplett ausgetauscht werden sollte.
- Eine zu geringe Sauerstoffaufnahme fördert hierbei Konzentrationsstörungen, Müdigkeit, aber kann auch zu ernsthaften gesundheitlichen Schäden führen. Eine CO²-Konzentration von 8-10 % kann hierbei zu Bewusstlosigkeit und innerhalb von 45 Minuten zum Tode führen.
- Elektrisch betriebene Lüfter können im Schlafraum nachts für den notwendigen Luftwechsel sorgen, im Optimalfall mit Wärmerückgewinnung (Wirkungsgrad 85%) energieverlustarm. Die elektrische Energieaufnahme liegt je nach Modell und Motorleistung in der empfohlenen unteren Bedienstufe zwischen 5 und 15 Watt. Bei einer Luftleistung von ca. 16 m³/h ergeben sich hier im Schlaffraum elektrische Leistungsaufnahmen von etwa 5 Watt/h, was in 8 Stunden Nachtbetrieb zu einem Energieverbrauch von 0,04 kWh und rechnerischen Kosten pro Nacht in Höhe von unter 2 Cent führt.
- die von uns favorisierten Lüftungsgeräte eines namhaften Herstellers besitzen einen einzigartigen Wärmetauscher mit einer nicht nur effizienten Wärme-, sondern auch für einer optimierten Feuchterückgewinnung. So kann gerade im Winter trockene Raumluft verhindert werden – was die Wohnqualität steigert und letztendlich auch der Gesundheit zugutekommt.
- Das für den Schlafraum von uns verwendete Lüftungsgerät besitzt in der empfohlenen unteren Leistungsstufe in 1,5 m Entfernung einen Schalldruckpegel von lediglich 15 dB(A), was zwischen dem Geräusch von Schneefall und einem leisen Blätterrauschen liegt.